EU-Plan: Börsengewinne für die Ukraine?
Von der Leyen will das eingefrorene Vermögen der russischen Zentralbank an der Börse anlegen und die Gewinne der Ukraine geben. Eine schräge Idee!
Das Motiv ist ehrenwert. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die Ukraine finanziell unterstützen. Dafür sollen russische Vermögen herhalten. Allerdings gibt es große rechtliche Hürden. Denn das eingefrorene Vermögen darf bei Sanktionen nur stillgelegt, aber nicht einfach enteignet werden. Sobald die Sanktionen wegfallen, muss das Vermögen gar wieder aufgetaut werden. Dann dürfen die russische Zentralbank und die russischen Oligarchen damit wieder machen, was sie wollen. Auch wenn es sich falsch anfühlt.
Von der Leyen will die rechtlichen Hürden umgehen. Das brachte sie auf einen so naiven wie entlarvenden Vorschlag: Sie will die eingefrorenen Vermögen der russischen Zentralbank in eine Art Treuhandfonds geben. Es geht um rund 300 Milliarden Euro. Die soll der Fonds an der Börse anlegen, um Gewinne zu machen, die dann an Kiew überwiesen werden. Spekulationsgewinne, wenn man so will. Das Grundkapital von 300 Milliarden sei dadurch geschützt und könnte Russland nach Abschluss eines Friedensvertrages zurückgegeben werden. Am besten unter der Bedingung, dass Russland milliardenschwere Reparationen an die Ukraine leistet.
So klingt das im O-Ton von der Kommissionspräsidentin:
»Wir haben die Reserven der russischen Zentralbank in Höhe von 300 Milliarden Euro blockiert und das Geld russischer Oligarchen in Höhe von 19 Milliarden Euro eingefroren. Kurzfristig könnten wir gemeinsam mit unseren Partnern eine Struktur schaffen, um diese Mittel zu verwalten und zu investieren. Dann würden wir die Erlöse für die Ukraine verwenden. Und sobald die Sanktionen aufgehoben sind, sollten diese Mittel verwendet werden, damit Russland den Schaden, der der Ukraine entstanden ist, vollständig ersetzt. Wir werden mit unseren Partnern auf ein internationales Abkommen hinarbeiten, um dies zu ermöglichen.«
Naiv: Das Geld liegt nicht einfach herum
Naiv ist der Vorschlag, weil die praktische Umsetzung brenzlig ist. Die 300 Milliarden liegen nicht einfach als Guthaben auf einem Bankkonto, sondern gestreut über verschiedenste Anlageobjekte auf verschiedenen Konten. Die russische Zentralbank hat nämlich kein eigenes Konto im Eurosystem, sondern hält ihr Euro-Vermögen über Korrespondenzbanken, die wiederum Konten im Eurosystem haben. Zur Erklärung: »Eurosystem« meint die Europäische Zentralbank und die nationalen Zentralbanken der Länder, die den Euro eingeführt haben. Die 300 Milliarden der russischen Zentralbank liegen also bei europäischen Geschäftsbanken, die wiederum Konten bei der Bundesbank, der Banque de France, der Banca d’Italia und so weiter führen. Wo und zu welchem Teil, ist nicht öffentlich bekannt. Stichwort: Bankgeheimnis!
Außerdem bestehen die 300 Milliarden der russischen Zentralbank nicht nur aus Kontoguthaben, sondern auch aus Staatsanleihen und anderen Wertpapieren. Die 300 Milliarden sind also nicht alles liquide Mittel, die einfach so auf Knopfdruck angelegt werden könnten. Zum Teil sind sie gar schon anlegt und erwirtschaften Erträge in Form von Zinsen, Dividenden oder Kursgewinnen.
Um die 300 Milliarden für den Wiederaufbau anzulegen, müsste der Treuhandfonds die illiquiden Anlagen also beleihen, sprich: sie als Sicherheit für einen Kredit nehmen. Mit anderen Worten: Ein Großteil der 300 Milliarden müsste als neues Geld erzeugt werden, um sie anlegen zu können. Welche Bank soll dem Fonds den Kredit geben? Wer trägt das Risiko für etwaige Spekulationsverluste? Oder soll am Ende nur der Teil der 300 Milliarden angelegt werden, den Korrespondenzbanken als liquide Guthaben für die russische Zentralbank führen? Fragen über Fragen.
Blackbox: Geldsystem
Entlarvend ist der Vorschlag, weil selbst höchste Politiker wie von der Leyen zur Schau stellen, keinen Schimmer davon haben, wie unser Geldsystem funktioniert. Wenn die EU der Ukraine helfen will, dann müssen dafür keine Euros an der Börse angelegt werden. Euros entstehen ja nicht an der Börse, nein: sie vermehren sich da auch nicht, sondern sie werden auf Knopfdruck erzeugt. Etwa, wenn die EZB Anleihen kauft oder den Geschäftsbanken Kredite gibt. Die EU kann der Ukraine deshalb so viele Euros überweisen, wie sie will. Der Umweg, die russischen 300 Milliarden zu vermehren, ist nicht nur unnötig, er schränkt auch ein, wie viel Geld der Ukraine gegeben werden kann. Theoretisch könnten wir der Ukraine einfach neue 300 Milliarden überweisen.
Praktisch hat das Ganze gleichwohl einen Haken. Geld ist zwar nicht knapp, Ressourcen aber schon. Wenn die EU der Ukraine Euros in Milliardenhöhe überweist, um den Wiederaufbau zu unterstützen, dann werden die Euros ja ausgegeben, um Häuser zu sanieren, Brücken zu reparieren und Strommasten wieder aufzustellen. Das ist dringend nötig. Ukrainische Baufirmen könnte die Ukraine allerdings auch problemlos in der eigenen Währung bezahlen. Die kann sie selbst erzeugen!
Euros braucht die Ukraine eher, um europäische Firmen zu beauftragen oder aus der EU zu importieren. Das wiederum bedeutet, dass Handwerker und Materialien aus der EU in die Ukraine fließen. Gute Aufträge für die europäische Bauwirtschaft und die daran hängende Industrie. Allerdings ist genau die Branche ja ohnehin schon stark ausgelastet. Die Gefahr: Ein Wettbieten zwischen der EU und der Ukraine in der europäischen Bauwirtschaft, das die Preise nach oben treibt und den Investitionsstau in Deutschland vergrößert.
Aber: Moment! Sind es nicht genau die CDU-Politiker aus von der Leyens Partei, die tagein, tagaus über fehlende Fachkräfte klagen, sich bei Einwanderung querstellen und die hohe Inflationsrate mit Sparpolitik herunterbringen wollen? Wie passt das damit zusammen, neue Exportnachfrage zu generieren? Gar nicht. Die Zusammenhänge liegen für CDU-Politiker im toten Winkel.
Klar, der Vorschlag von der Leyens ist gut gemeint. Die vorgebrachte Kritik daran ist kein Plädoyer gegen Wiederaufbauhilfe. Im Gegenteil. Dafür braucht es aber auch wirtschaftspolitische Lösungen und keine undurchdachten Treuhandfonds. Vielmehr soll die Kritik zeigen, wie stumpfsinnig und widersprüchlich das ökonomische Verständnis hinter solchen Vorschlägen ist. Theoretisch und praktisch. Auf monetärer und realer Ebene.
Ach ja, 300 Milliarden frisches Geld an der Börse wären natürlich ein warmer Geldregen für die heutigen Anlegwer. Denn die 300 Milliarden kauften ja keine neuen Anleihen und Aktien, sondern böten nur den Preis für existierende nach oben. Wer an den Treuhandfonds verkauft, kann dann schöne neue Kursgewinne realisieren.
Tipp: Auch in meinem Buch »Der neue Wirtschaftskrieg« habe ich die finanziellen Zusammenhänge der Sanktionen beschrieben. Turns out: von der Leyen ist mit ihrem mageren Verständnis vom Geldsystem nicht allein. Hier könnt ihr das Buch bestellen.
Den Newsletter gibt es nur dank finanzieller Unterstützung. Wenn ihr den Newsletter gerne lest, erwägt doch ein Bezahl-Abo. Das gibt es schon für 5€ im Monat. Ein herzliches Danke an alle Unterstützer! :-)



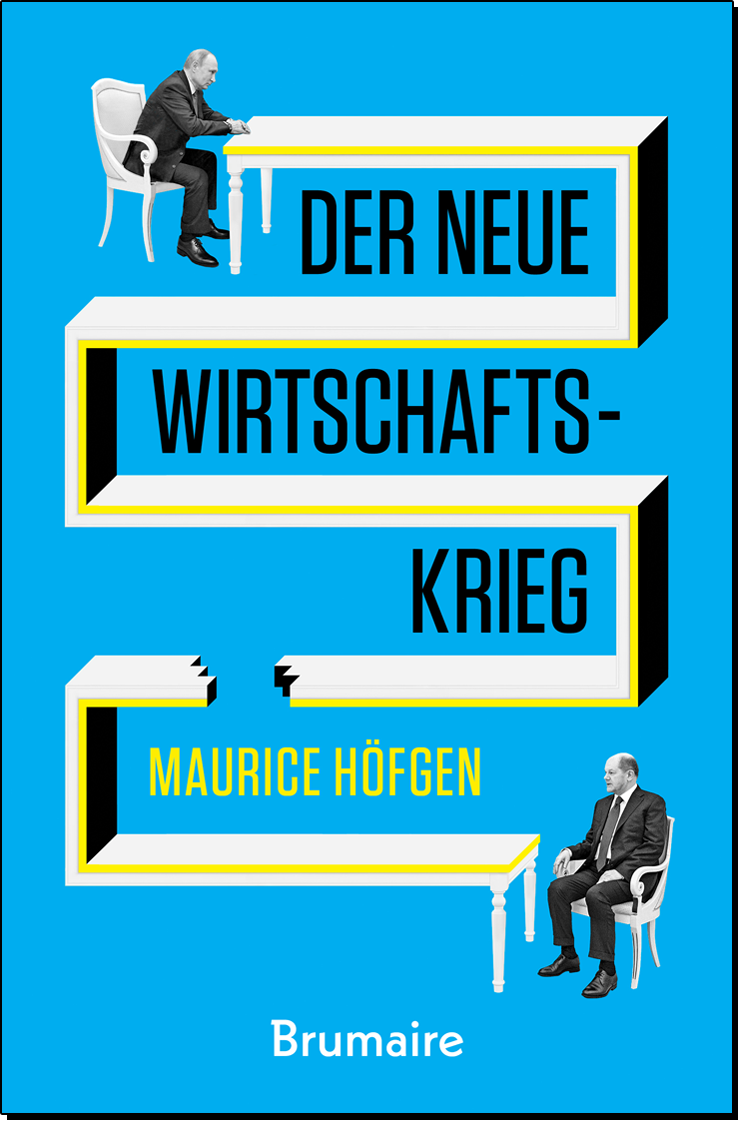
Im Artikel steht: "Die 300 Milliarden der russischen Zentralbank liegen also bei europäischen Geschäftsbanken, die wiederum Konten bei der Bundesbank, der Banque de France, der Banca d’Italia und so weiter führen. Wo und zu welchem Teil, ist nicht öffentlich bekannt. Stichwort: Bankgeheimnis!"
Wie weiß man, dass es 300 Mrd. sind? Frühere russische Veröffentlichungen? Welche Wege gäbe es offenzulegen, wo und wie viel liegt? In welchen anderen Fällen können diese Wege angewendet werden?